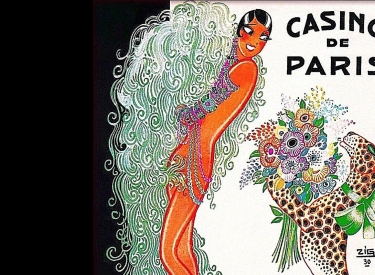Von Hunden und Katzen
Ein unter Deutschen beliebtes Vorurteil besagt, Wahlen in den USA seien reine Persönlichkeitswettbewerbe, oberflächlich und ohne politische Substanz. Aber das verwechselt die Form, in welcher der politische Konflikt geführt wird, mit der Sache.
Anders als in der deutschen Konsensdemokratie, wo in wechselnden Parteienkonstellationen die fast immer gleiche Große Koalition regiert, steht bei Abstimmungen in den USA wirklich etwas auf dem Spiel. Die Show drumherum steht dazu nicht im Widerspruch, sie ist Ausdruck bürgerlichen Selbstbewusstseins: Dafür, dass man seine Stimme abgibt, will man wenigstens etwas geboten bekommen.
Als Trump von Einwanderern schwadronierte, die die Haustiere der Einheimischen äßen, bedurfte es nur eines Augenrollens von Kamala Harris, um diese Peinlichkeit zu kommentieren.
Von dem, der an der Spitze steht, wird nicht bloß erwartet, das Land einigermaßen kompetent zu verwalten, sondern dabei auch noch eine gute Figur zu machen – mit dem Resultat, dass US-Präsidenten wie Ronald Reagan, Bill Clinton oder Barack Obama, was auch immer man sonst von ihnen halten mag, als Redner und Kommunikatoren ihren deutschen Pendants meilenweit überlegen waren.
In dieser Tradition steht der Auftritt der Vizepräsidentin Kamala Harris von der Demokratischen Partei in der wahrscheinlich einzigen Kandidatendebatte vor der Präsidentschaftswahl am 5. November, in der sie auf den ehemaligen Präsidenten Donald Trump von der Republikanischen Partei traf, übertragen am 10. September vom Sender ABC News.
Harris strahlte Souveränität aus
Ihren klaren Debattensieg, den selbst viele Konservative zähneknirschend anerkennen mussten, verdankte Harris nicht dem zwanglosen Zwang des besseren Arguments; nicht, mit anderen Worten, dem »Was« ihres Vortrags, sondern dem »Wie«. Mit ihren rhetorischen Finten, der perfekt choreographierten Mimik und Gestik strahlte Harris exakt jene Souveränität aus, die ihrem Kontrahenten abging.
Harris‘ Spitze über die Besucher, die gelangweilt seine Wahlkampfveranstaltungen verlassen würden, konnte Trump nicht ignorieren. Er reagierte mit einer mäandernden Verteidigung, die nicht bloß Redezeit vergeudete, sondern überdeutlich zeigte, wer in der Debatte die Oberhand hatte. Einen besseren Beweis für ihre These, dass sich für Trump alles nur um Trump dreht, hätte Harris sich nicht wünschen können.
Und als er schließlich anfing, von Einwanderern zu schwadronieren, die die Haustiere der Einheimischen äßen, bedurfte es nur eines Augenrollens, um die Peinlichkeit des Ganzen zu kommentieren. Als Machtgeste gegenüber einem, dem Machtgesten alles sind, war die Debatte für Harris ein voller Erfolg.
Existentielle Bedrohung durch Trump
Was will man auch mit einem Kandidaten, der indiskutabel ist, diskutieren? Das auf die Form und nicht den Inhalt zugeschnittene Rededuell stand sinnbildlich für die widersprüchliche Situation, in der sich die Demokraten – die Mitglieder der Partei wie auch die Anhänger der entsprechenden Regierungsform – bei der bevorstehenden Wahl befinden.
Einerseits weiß man, dass man es in Trump mit einer existentiellen Bedrohung zu tun hat: einem Präsidentschaftsanwärter, der die Verhaftung seiner politischen Gegner verspricht, dessen Hauptforderung in einer »ethnischen Säuberung« der US-amerikanischen Gesellschaft besteht, der Deportation von 20 Millionen Menschen als »illegale Einwanderer«, und der seine Geringschätzung fürs demokratische Prozedere bereits 2020, beim von ihm angestachelten Sturm aufs Kapitol, hinreichend unter Beweis gestellt hat. Weil aber der Kampf gegen diese Bedrohung in Form turnusgemäßer Wahlen ausgetragen wird, müssen andererseits alle Seiten so tun, als handle es sich um business as usual.
Dieser Widerspruch führt insbesondere in den alten Medien, den traditionellen Orten politischer Meinungsbildung, zu teils bizarren Resultaten. New York Times und Washington Post dokumentieren gewissenhaft die autoritären Wünsche Trumps und seiner Partei. Zugleich bemüht man sich, den Lesern Trumps Wortsalat in kohärente Programmatik zu übersetzen – und filtert damit stets das Irrste und Anstößigste heraus.
Und weil man zudem stets bestrebt ist, die eigene Unabhängigkeit unter Beweis zu stellen, müssen immer beide Seiten kritisiert werden: Trump will unbotmäßige Fernsehsender mundtot machen, aber Harris gibt zu wenig Interviews und hat noch kein klares Programm zur Steuerpolitik abgeliefert. Seinen Höhepunkt fand diese Form der Berichterstattung in einem Beitrag der New York Times, der die Wohnungspolitik der beiden Kandidaten verglich. Harris wolle den Hauskauf von Neueigentümern mit Steuerermäßigungen subventionieren, Trump durch Massenabschiebungen Wohnraum schaffen – aber Experten seien in beiden Fällen skeptisch, ob das zum Erfolg führe.
Die als »liberal« verschrienen Medien stehen vor dem gleichen Problem wie die Demokratische Partei: Die immergleichen Skandale mit der immergleichen Empörung anzuprangern, ohne dass daraus irgendetwas folgt, trägt zu deren Normalisierung bei.
Liberale und Linke zeigen sich über diese Art der Normalisierung des Autoritarismus empört. Gemutmaßt wird, in den Redaktionsstuben wäre man insgeheim hocherfreut, wenn Trump die Wahl gewänne; er verspreche schließlich Auflage und den reichen Besitzern obendrein noch weitere Steuersenkungen.
Ganz unplausibel ist das nicht – aber vielleicht nicht die einzige denkbare Erklärung. Die als »liberal« verschrienen Medien stehen vor dem gleichen Problem wie die Demokratische Partei: Die immergleichen Skandale mit der immergleichen Empörung anzuprangern, ohne dass daraus irgendetwas folgt, trägt zu deren Normalisierung bei. Man könnte genauso gut einem Stein ins Gewissen reden, an dem man sich den Fuß gestoßen hat. Kein Wunder, wenn Wähler das Interesse verlieren.
Harris und ihr Team haben darum ein strategisches Interesse, den Kampf gegen Trump wie einen ganz normalen Wahlkampf zu führen. Symbolisch dafür stand der Handschlag vor der Debatte, den Hillary Clinton und der amtierende US-Präsident Joe Biden Trump noch verweigert hatten.
Insbesondere Bidens Wiederwahlkampagne war ganz und gar auf die Warnung zugeschnitten, die Demokratie selbst stehe auf dem Spiel; bei Harris ist das deutlich in den Hintergrund getreten. Man will Trump nicht den Gefallen tun, ihn zum gefährlichen Desperado aufzubauen, der das Zeug zum starken Mann hat.
Spott über das Würstchen, das vor sich hinschwadroniert
Bei jenem kleinen Häufchen unentschlossener Wähler, die in den swing states letztlich den gesamten Wahlausgang bestimmen könnten – per definitionem die ignorantesten –, kann das leicht als Kompliment durchgehen. Mit weihevollen Reden über die Segnungen der Volkssouveränität sind diese Wähler kaum zu überzeugen; mit Spott über das Würstchen, das vor sich hinschwadroniert, schon eher, insbesondere wenn man es mit einem Appell an die Geldbörse verbindet. Trumps geplante Einfuhrzölle würden die Wähler teuer zu stehen kommen, betont Harris immer wieder; es geht um materielles Interesse und personality: exakt das also, worum in der US-Geschichte noch so gut wie jeder Wahlkampf geführt worden ist.
Und Trump? Seine Niederlage in der Debatte, die er natürlich verleugnete, hat ihn, wie die darauffolgenden Auftritte und Postings deutlich machten, ordentlich durchgerüttelt. Vor einer weiteren Fernsehdebatte mit Harris kniff er und proklamierte lieber seine neueste Geschäftsidee, die Trump-Kryptowährung. Gemeinsam mit seinen Söhnen hat Trump am Montag seine neue Plattform World Liberty Financial vorgestellt, Details jedoch nicht verraten, vor allem nicht, welche Finanzdienstleistungen dort angeboten werden sollen, die es nicht schon längst auf ähnlichen Krypto-Plattformen gibt.
»I hate Taylor Swift«, schrieb er am Sonntag bei X, ganz in Großbuchstaben, nachdem der Popstar sich für Harris ausgesprochen hatte – auch als Reaktion auf ein von Trump im August auf seinem Truth-Social-Account geteiltes gefälschtes Bild von Swift, auf dem zu lesen ist: »Taylor will, dass du für Donald Trump stimmst«.
Trumps Superkraft heißt Schamlosigkeit
Das alles ist normalerweise nicht die effektivste Art, bei den Wählern zu punkten. Aber fortschreitende Dekomposition ist in Trumps Fall gerade der Normalzustand – und Schamlosigkeit seine Superkraft. Direkt nach der Fernsehdebatte zeigte sich das republikanische Führungspersonal von Trumps Geraune über die Einwanderer, die Hunde und Katzen äßen, noch peinlich berührt.
Aber Trump blieb bei seiner Darstellung, gab den Übeltätern Namen und Anschrift – eine haitianische Community in der Kleinstadt Springfield, Ohio, wo die urban legend jüngst per Facebook-Post verbreitet worden war – und erhielt prompt Unterstützung von republikanischen Abgeordneten, die auf X Memes von Trump als Retter süßer Katzenbabys verbreiteten. Sein Vizekandidat J. D. Vance meinte anschließend im Interview, ob die Sache stimme oder nicht, sei irrelevant, solange man die Medien dazu zwinge, über sie zu berichten.
Nicht dass Trump eine Show abliefert, unterscheidet ihn von seinen präsidialen Vorgängern – sondern dass die Show, wie in jeder faschistischen Größenphantasie, die Substanz der ganzen Sache ist. Die Welt in eine Bühne imaginärer Machtgesten verwandeln heißt, reale Menschen leiden zu lassen. So weigerte sich Trump demonstrativ, die Bombendrohungen zu verurteilen, die seit der Debatte Springfields haitianische Einwohner in Angst und Schrecken versetzen.
Trump weigerte sich demonstrativ, die Bombendrohungen zu verurteilen, die seit der Debatte Springfields haitianische Einwohner in Angst und Schrecken versetzen.
Man kann hoffen, dass das denjenigen Wählern, auf die es ankommt, womöglich dann doch einen Schritt zu weit geht. Verlassen sollte man sich darauf nicht. Auch die Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton gewann 2016 alle Fernsehdebatten mit Trump deutlich, und die Empörung über dessen rassistische Ausfälle war schon damals groß. Das Ergebnis ist bekannt.
Dem Sender CNN zufolge führt Harris in Umfragen kurz nach der Debatte mit 52 Prozent knapp vor Trump mit 46 Prozent – wobei sich ihr Vorsprung gegenüber Ende August kaum verändert hat. Wie sich der mutmaßliche Anschlagsversuch vom Sonntag – der zweite innerhalb von zwei Monaten – auf Trumps Wahlkampf auswirken wird, lässt sich noch nicht abschätzen.



 Straight Out of Gotham City
Straight Out of Gotham City